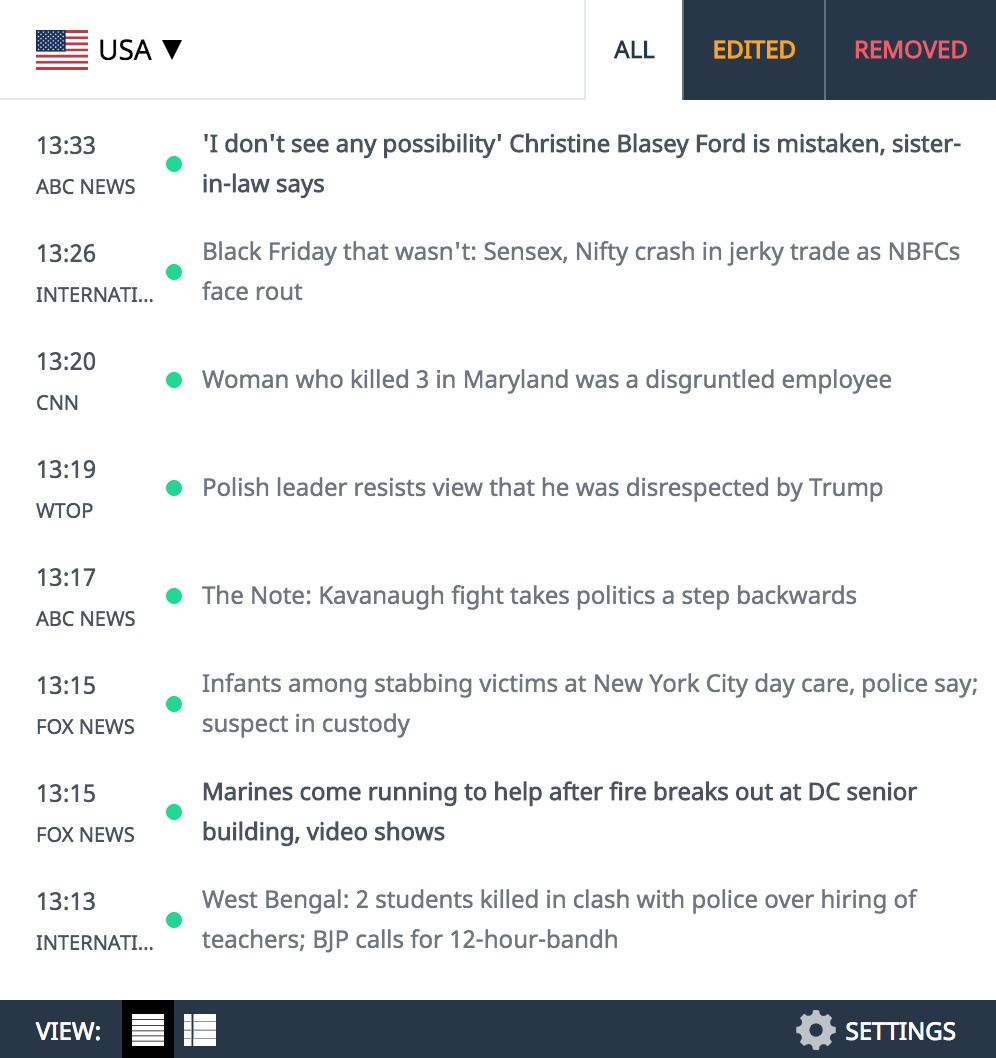Eingang zu einem Shoppingcenter in Peking.Bild: keystone
Interview
Die Schwellenländer werden diesmal nicht das Opfer der Bankenkrise, und China kann nicht mit dem Westen brechen. Weshalb das so ist, erklärt James Johnstone, Experte für Emerging Markets bei der britischen Investmentgesellschaft Redwheel.
Die Finanzwelt befindet sich in Aufruhr. Wie schlimm wird es noch werden?
Die Menschheit braucht grundsätzlich drei Dinge: billige Güter, billige Arbeit und billige Energie. In den letzten 30 Jahren hat dies bestens geklappt: China lieferte billige Güter und Arbeit, Russland billige Energie. China wurde zur Werkstatt der Welt, sein Anteil an der weltweiten Produktion von Gütern stieg von 3 auf 26 Prozent.
Warum ist jetzt damit Schluss?
China will nicht weiter billige Arbeit liefern. Seine Bevölkerung wird älter. Wenn die Chinesen verhindern wollen, dass sie alt werden, bevor sich wohlhabend werden, dann sollten sie sich um ihre Binnenwirtschaft kümmern und die Löhne dramatisch ansteigen lassen.
Und die billige Energie aus Russland ist ebenfalls Geschichte.
Richtig, deshalb geht die Gleichung nicht mehr auf. Das Resultat ist die Inflation, unter der wir heute leiden. Und das wiederum hat die Zentralbanken gezwungen, in kurzer Zeit die Leitzinsen in die Höhe zu treiben.
Kennt sich bei Schwellenländern aus: James Johnstone.
Was sind die Folgen für die reale Wirtschaft?
Sie wird zunehmend von den Schwellenländern dominiert. Immerhin leben dort 80 Prozent der menschlichen Bevölkerung.
Sie würden also dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zustimmen, dass wir in einer Zeitenwende leben?
Wir befinden uns an einem sehr wichtigen Wendepunkt der Menschheit. Sehen Sie, vor zehn Jahren hätten die Mehrheit meiner Kleider, die ich jetzt am Körper trage, das Label «made in China» gehabt, von den elektronischen Geräten gar nicht zu sprechen. Heute habe ich ein Smartphone, das in Vietnam gefertigt wurde – es ist übrigens super –, mein Anzug stammt aus der Türkei, meine Schuhe aus Indonesien, mein Hemd aus Bangladesch und meine Unterwäsche aus Pakistan.
Der Westen will sich ja von der Abhängigkeit von China zumindest teilweise befreien. Wo ist also das Problem?
Ich glaube nicht, dass es so rasch gehen wird. Der Westen und China sind nach wie vor aufeinander angewiesen. Die Stimmung hat sich jedoch merklich abgekühlt, vor allem zwischen den USA und China.
Man spricht bereits von einem neuen Kalten Krieg.
Ökonomisch gesehen ist dies Unsinn. Die Sowjetunion war wirtschaftlich niemals so mächtig, wie China heute ist. China ist zudem mittlerweile ein bedeutender Wirtschafts-Player in den Schwellenländern geworden. Denken Sie bloss an die sogenannte «Belt and Road Initiative».
«Rohstoffe und Tourismus genügen nicht, um auf einen Pfad zu gelangen, der zu Wohlstand führt.»
Westliche Unternehmen wie Apple versuchen daher, in andere Schwellenländer wie Vietnam auszuweichen.
Das ist die Chance dieser Länder. Elon Musk will seine nächste Tesla-Fabrik in Mexiko bauen lassen. Bangladesch erlebt einen bisher noch nicht gekannten Wirtschaftsaufschwung. Ich bin überzeugt, dass die Schwellenländer für die Weltwirtschaft so wichtig werden wie schon lange nicht mehr.
Nun, es gibt jedoch den bösen Spruch: Brasilien ist das Land der Zukunft – und wird es immer bleiben. Trifft das nicht auch auf die meisten anderen Schwellenländer zu?
Man muss sicher sehr sorgfältig unterscheiden, welche Länder es schaffen werden und welche nicht. Es ist, wie Lew Tolstoi zu Beginn seines Romans «Anna Karenina» schreibt: «Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise.»
Welches sind nun die glücklichen, und welche die unglücklichen Familien, respektive Schwellenländer?
Eine sehr unglückliche Familie ist beispielsweise Zimbabwe. Dabei befand sich das Land bis zur Jahrhundertwende auf einem wunderbaren Weg. Venezuela hat die grössten Ölreserven der Welt, eine gut ausgebildete Bevölkerung und befindet sich in der Nähe der USA. Eigentlich müsste das Land die grösste Erfolgsstory der Welt sein. Wie Zimbabwe ist es an einer katastrophalen Politik gescheitert.
Was lernen wir daraus?
Rohstoffe und Tourismus genügen nicht, um auf einen Pfad zu gelangen, der zu Wohlstand führt.
Hat es geschafft: der Stadtstaat Singapur.Bild: CATERSNEWS DUKAS
Und was sind nun glückliche Familien?
Das klassische Beispiel ist natürlich Singapur. Noch in den Sechzigerjahren war es sehr heiss und sehr arm. Heute ist es immer noch sehr heiss, aber eines der reichsten Länder der Welt. Polen ist ebenfalls eine unglaubliche Erfolgsstory – und natürlich China. Dort ist es gelungen, rund 750 Millionen Menschen aus schlimmster Armut zu befreien.
Können Sie den Erfolg der Schwellenländer in Zahlen fassen?
Sicher. In den Sechzigerjahren betrug deren Anteil an der Weltwirtschaft rund 20 Prozent, heute sind es 60 Prozent. So gesehen haben sich die Schwellenländer in den letzten Jahrzehnten sehr gut geschlagen.
Derzeit herrscht grosse Angst in der Finanzgemeinde. Das bedeutet, dass alle Investoren in «sichere Häfen» flüchten. Der wichtigste Hafen sind nach wie vor die USA. Das bedeutet, dass der Dollar stärker wird, zumal die Fed auch noch die Zinsen angehoben hat. Ein starker Dollar war in der Vergangenheit stets Gift für die Schwellenländer. Weshalb sollte es diesmal anders sein?
Als die Zentralbanken vor einem Jahr mit ihren Zinserhöhungen begannen, hiess es innerhalb der Finanzgemeinde, die indonesische Währung werde unter die Räder kommen. Wissen Sie, welche Währung in jüngster Zeit am meisten gegen den Dollar verloren hat? Der japanische Yen. Die meisten Schwellenländer sind indes bisher ziemlich gut mit den Zinserhöhungen klargekommen.
«Die Chinesen haben aufgeräumt.»
Wie erklären Sie das?
Heute sind es ausgerechnet die Schwellenländer, die mehrheitlich eine sehr vernünftige Fiskal- und Geldpolitik betreiben. Während viele westliche Zentralbanken Geld wie blöd gedruckt haben, haben die meisten Zentralbanken ihre Leitzinsen früh und aggressiv angehoben, um eine Inflation zu vermeiden. Es sind vor allem die reichen G7-Länder, die ihre Währungen haben verkommen lassen.
China hat ebenfalls kräftig Schulden gemacht.
Ja, aber die Chinesen haben inzwischen aufgeräumt. In den letzten fünf Jahren haben sie grosse Anstrengungen unternommen, um die Schäden, die riesige Blasen – vor allem im Immobiliensektor – angerichtet habe, zu beheben. Deshalb konnte die chinesische Zentralbank als erste den Leitzins wieder senken. Wir im Westen sitzen hingegen auf einem riesigen Schuldenberg, den wir mittels Inflation wieder abzutragen versuchen.
Ist das ein Grund, weshalb viele Schwellenländer nicht mehr nach Westen, sondern nach Osten blicken?
Teilweise. Ich glaube jedoch nicht, dass wir auf ein chinesisches Jahrhundert zusteuern. Ich glaube an ein Jahrhundert der Schwellenländer.
Weshalb?
Der Westen will seine Wirtschaft dekarbonisieren und auf Elektrizität umstellen. Was braucht er da? Riesige Mengen an Kupfer, Kobalt, Lithium, etc. Die meisten dieser Rohstoffe befinden sich in den Schwellenländern. Wir hingegen haben in die Digitalisierung investiert. Inzwischen haben wir zwar jede Menge Apps, mit denen wir jede Menge Güter bestellen können. Was wir jedoch nicht mehr haben, sind billige Arbeitskräfte und billige Energie. Dazu brauchen wir die Schwellenländer.
Eine Kupfermine im Kongo.Bild: Getty
Die Schwellenländer ihrerseits müssen zunehmend wählen, ob sie sich für den Westen oder für China entscheiden wollen.
Aller kriegerischen Tönen zum Trotz ist China nach wie vor sehr stark mit dem Westen verbandelt. Denken Sie nur an die Abhängigkeit von Halbleitern. Ohne wirtschaftliche Verknüpfung mit dem Westen kann die chinesische Regierung ihr Versprechen gegenüber der Bevölkerung nicht einlösen, das da in Kurzform lautet: Ihr verzichtet auf Demokratie und wir liefern euch wachsenden Wohlstand.
Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass sich Handelsbeziehungen sehr rasch auflösen können.
Russland lieferte primär Öl und Gas. Ein milder Winter und rasches Handeln haben dazu geführt, dass diese Abhängigkeit erstaunlich rasch überwunden werden konnte. Die wirtschaftlichen Verknüpfungen mit China sind jedoch weit komplexer.
Trotzdem ist immer öfters die Rede von einem Krieg zwischen den USA und China.
Ich kann nur nochmals betonen: Ich glaube nicht daran. Eine militärische Invasion von Taiwan wäre sehr schwierig, und die Chinesen können derzeit in Echtzeit zuschauen, welche Probleme die Russen in der Ukraine haben. Grundsätzlich bin ich daher optimistisch eingestellt.
Und das bedeutet konkret?
Dass auch China zur Einsicht gelangt, dass es die symbolische Beziehung zum Westen nach wie vor braucht. Wir müssen deswegen ja nicht die besten Freunde werden.